Die Kündigungsfrist für Arbeitnehmer: Wie lange ist meine Kündigungsfrist?
Ob Jobwechsel, betriebsbedingte Kündigung oder schlicht der Wunsch nach Neuorientierung: Wer ein Arbeitsverhältnis kündigen möchte, stößt unweigerlich auf die Frage „Wie lange ist meine Kündigungsfrist?“.
Dieser umfassende Leitfaden erklärt Schritt für Schritt, welche gesetzlichen, vertraglichen oder tariflichen Regelungen zur Kündigungsfrist gelten, wie Sie Ihre individuelle Kündigungsfrist berechnen und welche Fallstricke drohen, wenn die fristgerechte Kündigung versäumt wird.
Der Unterschied zwischen vertraglichen und gesetzlichen Kündigungsfristen
Gilt die vertragliche oder die gesetzliche Kündigungsfrist vorrangig?
Vertragliche Kündigungsfristen gehen gesetzlichen Kündigungsfristen vor, wenn sie für den Arbeitnehmer vorteilhafter sind. Längere Kündigungsfristen gelten als vorteilhaft, weil Arbeitnehmer so besser und länger auf eine Kündigung reagieren können.
Tipp: Steht im Vertrag pauschal „Die gesetzliche Kündigungsfrist gilt.“, dann greift automatisch die gesetzliche Kündigungsfrist des § 622 BGB.
Es gibt aber einige Ausnahmen, die es zu beachten gilt:
- Die Kündigungsfrist des Arbeitgebers darf nicht kürzer als die Kündigungsfrist des Arbeitnehmers sein, § 622 Abs. 6 BGB. Bei einem Verstoß fällt die rechtswidrige Regelung weg und es greift entweder die einschlägige „Normalfrist“ aus § 622 Abs. 2 BGB, oder eine Frist derselben Länge wie die Kündigungsfrist des Arbeitnehmers. Das entscheidet sich danach, welche Frist im Einzelfall die längere ist.
- Der Arbeitsvertrag darf keine kürzere Kündigungsfrist als die gesetzliche Mindestfrist von vier Wochen zum 15. Oder zum Monatsende vorsehen. Diese Regelung hat nur zwei Rückausnahmen, wo ausnahmsweise kürzere Kündigungsfristen im Arbeitsvertrag vereinbar sind:
- In Kleinbetrieben (unter 20 Mitarbeitende; Teilzeitarbeitende unter 20 Wochenstunden zählen 0,5 oder unter 30 Wochenstunden 0,75) kann vereinbart werden, dass die Kündigung ohne festen Kündigungstermin wirksam ist. Eine Kündigung wird in diesem Fall exakt vier Wochen später wirksam und muss nicht auf den 15. Tag oder auf ein Monatsende fallen. Die Mindestlänge beträgt trotzdem noch vier Wochen.
- Bei Aushilfsarbeitern, wenn sie nicht länger als drei Monate beschäftigt sind.

Der Unterschied zwischen vertraglichen und gesetzlichen Kündigungsfristen
Was gilt, wenn ein Tarifvertrag vorliegt?
In Branchen mit Tarifbindung gelten oft spezielle Regelungen, die dem Gesetz vorgehen. Besonders im öffentlichen Dienst (bspw. TVöD), der Metall- und Chemieindustrie, der Pflege, aber auch in anderen Berufszweigen existieren Tarifverträge. Prüfen Sie immer zuerst, ob überhaupt ein Manteltarifvertrag oder der TVöD/TV‑L Anwendung findet.
Eine tarifvertragliche Kündigungsfrist darf, anders als ein Arbeitsvertrag, die gesetzlichen Kündigungsfristen unterschreiten, § 622 Abs. 4 BGB. In diesem Fall findet das Günstigkeitsprinzip keine Anwendung.
Was ist das Günstigkeitsprinzip?
Im Arbeitsrecht gilt das Prinzip, dass der Arbeitnehmer in den Genuss der für ihn günstigsten Regelung kommen soll: Auch dann, wenn höherrangiges Recht dagegensteht, setzt sich dann das unterrangige, aber arbeitnehmerfreundlichere Recht durch. Der häufigste Anwendungsfall ist der, dass ein Arbeitsvertrag eine für den Arbeitnehmer günstigere Kündigungsfrist als der entsprechende Tarifvertrag vorsieht. Die anknüpfende Norm ist § 4 Abs. 3 TVG.
Was im Einzelfall „günstig“ ist, entscheidet sich nicht nach den individuellen Interessen, sondern aus dem objektiven Blick eines durchschnittlichen Arbeitnehmers. Eine längere Kündigungsfrist ist aus Gründen der Jobsicherheit und der längeren Reaktionszeit auf eine Kündigung stets objektiv „günstiger“ für einen Arbeitnehmer.
Wichtig: Die „günstigere“ längere Frist greift sogar dann, wenn individuell eine kurze Kündigungsfrist besser wäre!
Beispiel nach BAG, Urt. v. 20.01.2015, 2 AZR 280/14: Angenommen, Ihr Arbeitsvertrag sieht eine Kündigungsfrist von acht Wochen vor. In den ersten fünf Jahren ist diese Frist für Sie günstiger als die gesetzliche Grundfrist von vier Wochen. Nach Ablauf der ersten fünf Jahre steigt die gesetzliche Frist jedoch auf zwei Monate an. Ab diesem Zeitpunkt ist die gesetzliche Regelung für Sie vorteilhafter. Daher greift zunächst die vertragliche Frist, ab dem dritten Jahr dagegen automatisch die längere gesetzliche Kündigungsfrist.
Auswirkungen einer nicht eingehaltenen Kündigungsfrist
Der Arbeitnehmer hält die Kündigungsfrist nicht ein
Kündigt ein Arbeitnehmer zu früh und verlässt den Arbeitsplatz bereits vor Ablauf der Frist, verletzt er seine Pflichten aus dem Arbeitsvertrag. Der Arbeitgeber kann Ersatz des entstandenen Schadens verlangen, zum Beispiel Kosten einer Leiharbeitskraft.

Auswirkungen einer nicht eingehaltenen Kündigungsfrist
Der Arbeitgeber hält die Kündigungsfrist nicht ein
Kündigt der Arbeitgeber fristwidrig, kann der Arbeitnehmer Annahmeverzugslohn fordern. Eine falsch ermittelte Kündigungsfrist endet damit oft kostspielig. Jeder Arbeitgeber sollte ordentliche Kündigungen daher fristgerecht sowie nachweisbar (Einschreiben, Bote) zustellen.
Die gesetzliche Kündigungsfrist für Arbeitnehmer
Die gesetzliche Kündigungsfrist ist in § 622 BGB geregelt. Sie unterscheidet sich danach, ob der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer kündigt. Für die Kündigung durch den Arbeitgeber ist zudem die Dauer der Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers entscheidend. Eine Kündigung langjähriger Mitarbeiter bringt mitunter lange Fristen mit sich.
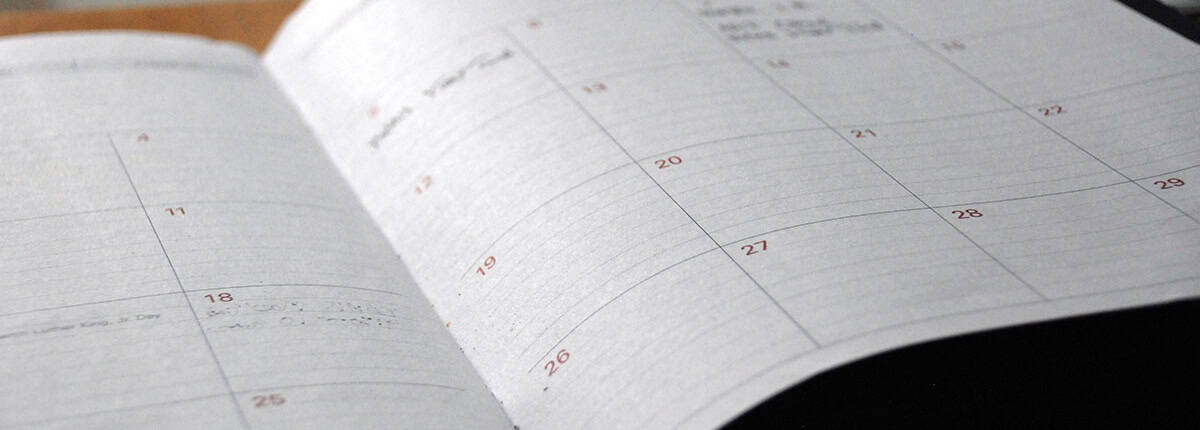
Die gesetzliche Kündigungsfrist für Arbeitnehmer
| Betriebszugehörigkeit | Kündigungsfrist Arbeitnehmer (§ 622 Abs. 1 BGB) | Kündigungsfrist Arbeitgeber (§ 622 Abs. 2 BGB) |
| bis 2 Jahre | 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende | 4 Wochen zum 15. oder Monatsende |
| 2 bis 5 Jahre | 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende | 1 Monat zum Monatsende |
| 5 bis 8 Jahre | 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende | 2 Monate zum Monatsende |
| 8 bis 10 Jahre | 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende | 3 Monate zum Monatsende |
| 10 bis 12 Jahre | 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende | 4 Monate zum Monatsende |
| 12 bis 15 Jahre | 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende | 5 Monate zum Monatsende |
| 15 bis 20 Jahre | 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende | 6 Monate zum Monatsende |
| ab 20 Jahren | 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende | 7 Monate zum Monatsende |
Die Kündigungsfrist im öffentlichen Dienst nach TVöD
Die Kündigungsfrist des TVöD bemisst sich einerseits nach Ihrer Beschäftigungszeit und andererseits danach, ob das Arbeitsverhältnis befristet oder unbefristet besteht. Bei der Berechnung der Beschäftigungszeit können Vorbeschäftigungen bei anderen Arbeitgebern nach TV-L oder bei anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern anerkannt werden.

Die Kündigungsfrist im öffentlichen Dienst nach TVöD
Kündigungsfrist nach TVöD für unbefristete Arbeitsverhältnisse
Für unbefristete Arbeitsverhältnisse nach TVöD gelten folgende Kündigungsfristen:
| Beschäftigungszeit | Kündigungsfrist Arbeitgeber und Arbeitnehmer |
| weniger als 6 Monate | 2 Wochen zum Monatsende |
| bis zu 1 Jahr | 1 Monat zum Monatsende |
| mehr als 1 Jahr | 6 Wochen zum Quartalsende |
| mindestens 5 Jahre | 3 Monate zum Quartalsende |
| mindestens 8 Jahre | 4 Monate zum Quartalsende |
| mindestens 10 Jahre | 5 Monate zum Quartalsende |
| mindestens 12 Jahre | 6 Monate zum Quartalsende |
Ein besonderer tariflicher Kündigungsschutz („Unkündbarkeit„) besteht für Beschäftigte im Tarifgebiet West, die mindestens 15 Jahre beim selben Arbeitgeber beschäftigt waren und mindestens 40 Jahre alt sind. Seit dem 01. August 2025 gelten die Regelungen über die Unkündbarkeit zumindest für Bundes-Beschäftigte auch im Tarifgebiet Ost.
Kündigungsfrist nach TVöD für befristete Arbeitsverhältnisse
Für befristete Arbeitsverhältnisse nach TVöD gelten, wenn vertraglich überhaupt eine ordentliche Kündigung zugelassen ist, folgende Kündigungsfristen:
| Beschäftigungszeit | Kündigungsfrist Arbeitgeber und Arbeitnehmer |
| Bis Ablauf der Probezeit | 2 Wochen zum Monatsende |
| mehr als 6 Monate | 4 Wochen zum Monatsende |
| mehr als 1 Jahr | 6 Wochen zum Quartalsende |
| mehr als 2 Jahre | 3 Monate zum Quartalsende |
| mehr als 3 Jahre | 4 Monate zum Quartalsende |
Die Kündigungsfrist in der Probezeit
Ein wesentlicher Punkt der Probezeit ist die verkürzte Kündigungsfrist. Sofern keine abweichende Regelung getroffen wurde, beträgt sie nach § 622 Abs. 3 BGB lediglich zwei Wochen. Im TVöD gilt ebenfalls eine Zwei-Wochen-Frist, jedoch immer zum Monatsende.

Die Kündigungsfrist in der Probezeit
Im Arbeitsvertrag kann eine andere Frist vereinbart werden, solange sie die gesetzliche Mindestdauer von zwei Wochen nicht unterschreitet. Hier finden Sie weitere Informationen zur Kündigung am letzten Tag der Probezeit, bzw. zur Kündigung nach der Probezeit.
Die Kündigungsfrist bei Werkstudenten und Minijobs
Für Werkstudenten und Minijobber greifen, wenn nicht anders im Arbeitsvertrag geregelt, die gesetzlichen Kündigungsfristen: Also vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Monats.

Die Kündigungsfrist bei Werkstudenten und Minijobs
Tipps für die Berechnung Ihrer individuellen Kündigungsfrist
Folgende Hinweise sollten Sie sich zu Herzen nehmen, wenn Sie Ihre individuelle Kündigungsfrist berechnen wollen:
Arbeitsvertrag gründlich lesen
Suchen Sie nach Schlagworten wie „Kündigungsfrist“, „Beendigung des Arbeitsverhältnisses“ oder „Ordentliche Kündigung“. Achten Sie darauf, ob eine feste Frist (z. B. „3 Monate zum Quartalsende“) oder ein Verweis auf die gesetzliche Regelung vorhanden ist. Hiervon kann abhängen, ob der Arbeitsvertrag überhaupt anwendbar ist!
Tarifvertrag prüfen
Nach einer kurzen Websuche landen Sie meist auf Webseiten der ver.di‑ oder IG‑Metall‑Seiten. Laden Sie dort den vollständigen Tariftext herunter und kontrollieren Sie, ob Ihre Tätigkeit in den Geltungsbereich fällt. In den Tariftexten erfahren Sie auch die Kündigungsfristen.
Beachten Sie trotzdem das Günstigkeitsprinzip: Kontrollieren Sie in jedem Fall zusätzlich Ihren Arbeitsvertrag auf eine für Sie günstigere Kündigungsfrist.
Betriebszugehörigkeit korrekt ermitteln
Bei Arbeitgeberkündigungen verlängert sich die gesetzliche Kündigungsfrist ab zwei Jahren. Die Dauer der Zugehörigkeit beginnt mit dem ersten Arbeitstag und endet mit Ablauf des Austrittstages. Wer also am 1. Mai 2020 begann und am 30. April 2025 austritt, hat exakt 5 Jahre erreicht.
Ruhenszeiten wie Mutterschutz, Krankengeldbezug oder Elternzeit zählen grundsätzlich zur Dauer der Betriebszugehörigkeit hinzu. Kontrollieren Sie trotzdem, ob Sie hierzu abweichende Regelungen in den Vertragsunterlagen finden.
Fristbeginn der Kündigungsfrist richtig berechnen
Eine 4‑Wochen‑Frist entspricht 28 Tagen und nicht einem Kalendermonat. Kündigen Sie am 2. Januar, endet das Arbeitsverhältnis am 30. Januar.
Schriftform und Zugangsnachweis
Gemäß § 623 BGB ist die Kündigung des Arbeitsverhältnisses schriftlich zu erklären. Eine E‑Mail oder eine Nachricht auf WhatsApp reichen nicht. Nutzen Sie Einwurfeinschreiben oder einen Boten, um den Zugang beweissicher zu gestalten.
Sonderfälle beachten
Für besondere Personengruppen gelten Besonderheiten, die sich entscheidend auswirken:
- Die Kündigungsfrist bei Schwerbehinderten bleibt gleich, allerdings ist die Zustimmung des Integrationsamts erforderlich.
- In der Elternzeit ist die Kündigungsfrist einer arbeitnehmerseitigen Kündigung nach § 19 BEEG (3 Monate zum Ende der Elternzeit) verlängert. Der Arbeitgeber darf während der Elternzeit überhaupt nur in sehr engen Sonderfällen kündigen, § 18 BEEG.
- Bei einem Aufhebungsvertrag können Kündigungsfristen umgangen werden. Dies sollten Sie allerdings als Arbeitnehmer nur tun, wenn Sie gleichzeitig im Gegenzug eine Abfindungszahlung vereinbaren.
- Für Angestellte in Probezeit gelten kürzere Kündigungsfristen. Bei befristeten Angestellten ist nur dann eine ordentliche Kündigung mit Kündigungsfrist möglich, wenn dies vertraglich vereinbart ist, § 15 Abs. 4 TzBfG.
Fazit
Eine korrekt berechnete Kündigungsfrist schützt vor finanziellen Nachteilen, streitbedingten Stress und einem schlechten Image. Arbeitnehmer, die ihre Frist exakt kennen, können den Jobwechsel strategisch planen, Arbeitgeber vermeiden kostspielige Prozessrisiken.
Kündigungsfristen können in den Einzelheiten sehr kompliziert und undurchsichtig wirken. Lassen Sie sich anwaltlich beraten, wenn Sie sich unsicher sind.
Was unsere Mandanten über Dr. Drees, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, sagen



Fachlich stark, menschlich großartig - eine klare, Empfehlung!
Bei Bedarf werde ich wieder auf seine Hilfe zurückgreifen.
Ein herzliches Dankeschön an Dr. Drees und sein Team.

Was ihn besonders auszeichnet, ist sein persönlicher Stil: Mit Leichtigkeit, positiver Ausstrahlung und großem Engagement schafft er es, auch in einer schwierigen Phase Sicherheit zu geben. Man spürt sofort, dass er nicht nur seinen Job macht, sondern sich wirklich für seine Mandanten einsetzt.
Absolut empfehlenswert!



